aus e-mail von Clemens Ronnefeldt, 7. Mai. 2025, 18:44 Uhr
Liebe Friedensinteressierte,
beiliegend sende ich einige Artikel zu den Kriegen
in der Ukraine und in Westasien - auch heute wieder
mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen
übereinstimme, die Artikel aber für relevant halte.
1. t-online: "Wissen nicht, was Russland tun wird“
Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert
2. Länderanalysen: Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:
Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen
3. RND: Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen
4. RND: Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus
5. n tv: Auch Vertreibung der Einwohner
Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel
6. Berl. Z: Israels Finanzminister:
Gazastreifen wird vollständig zerstört – Palästinenser wandern in Drittländer ab
7. taz: Hunger in Gaza
In Gaza gehen die letzten Lebensmittelvorräte aus
8. Medico International: medico-Partner:innen leisten unter unmöglichen Bedingungen Nothilfe
9. Die Zeit: Nahostkonflikt: Israel greift Ziele nahe syrischem Präsidentenpalast in Damaskus an
10. Bundestag: Antwort der Bundesregierung - Deutsche Kriegswaffenexporte nach Israel
11. Aufschrei: Das Völkerrecht kennt keine Staatsräson - Rüstungsexporte nach Israel stoppen!
Die Stärke des Rechts muss uneingeschränkt gelten!
12. Berl. Z.: Abschiebung von EU-Bürgern wegen Pro-Palästina-Protesten? Berliner Gericht hält dagegen
13. IPPNW: Faschismus, Rechtsextremismus und Militarismus sind untrennbar verbunden
Tag der Befreiung
———
1. t-online: "Wissen nicht, was Russland tun wird“
Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100704402/russland-selenskyj-warnt-staatschefs-vor-besuch-von-putins-militaerparade.html
"Wissen nicht, was Russland tun wird“
Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert
Von afp
Aktualisiert am 03.05.2025
Am 9. Mai will Russland eine große Feier zum "Tag des Sieges"
abhalten. Im Vorfeld spricht der ukrainische Präsident eine kryptische
Warnung aus. Der Kreml reagiert prompt.
Wolodymyr Selenskyj hat Staats- und Regierungschefs davor gewarnt, an
der Siegesparade in Moskau zum 80. Jahrestag der deutschen
Kapitulation im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. "Wir wissen nicht, was
Russland an diesem Tag tun wird.
Es könnte verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie Brände, Explosionen,
und uns dann die Schuld zuzuschieben", sagte der ukrainische Präsident
in einem am Samstag veröffentlichten Gespräch mit Journalisten unter
anderem der Nachrichtenagentur AFP.
Kiew könne daher nicht für die Sicherheit der Besucher der
Veranstaltung in der russischen Hauptstadt garantieren, sagte
Selenskyj weiter. Das Gespräch mit ihm fand am Freitag statt, der
Inhalt konnte aber erst am Samstag verbreitet werden.
Moskau reagierte prompt auf Selenskyjs Warnungen. Der Vize-Vorsitzende
des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, drohte der Ukraine
für den Fall eines Angriffs auf Moskau während der Feiern zum Sieg im
Zweiten Weltkrieg.
Niemand könne dann garantieren, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew
den 10. Mai erleben werde, teilte der Ex-Präsident und ehemalige
Ministerpräsident am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Internationale Gäste in Moskau erwartet
An den Feierlichkeiten in Moskau sollen internationale Gäste wie der
chinesische Präsident Xi Jinping und sein brasilianischer Amtskollege
Luiz Inácio Lula da Silva sowie die Staatschefs unter anderem von
Kasachstan, Belarus, Kuba und Venezuela teilnehmen.
Zu den Aussichten auf eine Waffenruhe zwischen der Ukraine und
Russland sagte Selenskyj, er wolle keine "Spielchen" mit den kurzen
Waffenruhen spielen, die der russische Präsident Wladimir Putin
vorgeschlagen habe. Putin hatte für die Zeit rund um das
Weltkriegsgedenken eine Waffenruhe zwischen 8. und 10. Mai
angekündigt. (…)
——
2. Länderanalysen: Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:
Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen
https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/314/kriegsverbrechen-und-kollaboration-in-der-geschichte-der-ukraine-historisches-erbe-aktuelle-herausforderungen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine-Analysen+314&newsletter=Ukraine-Analysen+314
Analyse
Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:
Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen
Von Tanja Penter (Universität Heidelberg)
(…)
Einleitung
Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa
zum 80. Mal. Zugleich erschüttert seit drei Jahren ein neuer Krieg
Europa: Russlands brutaler Angriff auf die Ukraine, in dem die
ukrainische Zivilbevölkerung erneut großes Leid erfährt.
Im Zweiten Weltkrieg stand die gesamte Ukraine unter brutaler
deutscher Besatzung, geprägt von Ausbeutung, Terror und systematischer
Gewalt. 1,5 Millionen Jüd:innen wurden in der Ukraine ermordet, ebenso
Zehntausende Romnja und Roma sowie kranke und behinderte Menschen.
2,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden zur Zwangsarbeit nach
Deutschland verschleppt. Mehr als 600 ukrainische Ortschaften wurden
unter deutscher Besatzung vollständig zerstört, viele samt ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner ausgelöscht.
Ungefähr 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden für die
sowjetische Armee mobilisiert und stellten ein Viertel der
sowjetischen Streitkräfte – eine Tatsache, die in der postsowjetischen
ukrainischen Erinnerungskultur an den Krieg zunehmend in Vergessenheit gerät.
Die Bevölkerungsverluste der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs
werden insgesamt auf 8–10 Millionen Menschen (Zivilist:innen und
Militärangehörige) geschätzt. Diese Millionen ukrainischer Kriegsopfer
stehen bis heute im Schatten der Geschichte und werden in der
deutschen Erinnerungskultur immer noch zu wenig gewürdigt.
Lange galt in Teilen von Politik und Öffentlichkeit fälschlich, die
Kriegsopfer der Sowjetunion seien vor allem Russen gewesen – und
Deutschlands historische Verantwortung bestehe daher primär gegenüber
Russland. Putin instrumentalisiert die Erinnerung an den »Großen
Vaterländischen Krieg«, um den Angriff auf die Ukraine zu
rechtfertigen und innenpolitisch Rückhalt zu gewinnen.
Der Sieg im Zweiten Weltkrieg wird so ideologisch für den heutigen
Krieg missbraucht, wie die Deutsch-Ukrainische Historische Kommission
in ihrem Appell an den Deutschen Bundestag anlässlich des 80.
Jahrestags des Kriegsendes anmerkt.[1]
Das Füllen dieser Erinnerungslücken an die oft übersehenen Orte
deutscher Massenverbrechen im Osten stellt eine dringende Aufgabe dar.
In einem gemeinsamen Projekt der Universität Heidelberg mit der
Internet-Plattform DEKODER wird am Beispiel von zehn Kriegsbiographien
Angehöriger verschiedener Opfergruppen das Leid der Zivilbevölkerung
im deutschen Vernichtungskrieg erzählt.[2]
(…)
Nach sowjetischen Angaben waren etwa 32.000 Sowjetfunktionär:innen und
über sieben Millionen Sowjetbürger:innen an der Sammlung von Beweisen
zur Aufklärung der deutschen Verbrechen beteiligt. Insgesamt trug die
ASK über 300.000 Aussagen von Zeug:innen und Befragungsprotokolle
sowie etwa vier Millionen Dokumente über von den Deutschen verursachte
Schäden zusammen.
Eindrücklich beschrieb der Schriftsteller Nikolaj Atarov diesen
Prozess in den gerade befreiten Gebieten:
»In diesen Tagen inmitten des Alltagsgeschehens – beim Graben durch
die Asche riesiger Brandruinen, auf der Suche nach einem Platz für die
Nacht oder nach einem vorbeifahrenden Wagen – überall wurden die
Menschen von dem spontanen Bedürfnis erfasst zu schreiben, zu
bezeugen. Stapel für Stapel von Zeugenaussagen gingen bei den
politischen Abteilungen der Regimenter und Divisionen ein. Sie waren
auf Fetzen von Gestapo-Formularen, auf der Rückseite von idiotischen
Goebbels-Postern oder, am häufigsten, in Schulheften niedergeschrieben
worden.«[5]
Die regionalen »Hilfskommissionen« der ASK bestanden meist aus Partei-
und NKWD-Funktionär:innen, angeführt von einer Trojka aus den
Vorsitzenden von Partei, Sowjets und NKWD (NKWD war die Geheimpolizei).
(…)
Die Staatskommission gehörte auch zu den ersten Institutionen, die
aktiv zur Formung stalinistischer Kriegsmythen beitrugen. Ihre
Mitteilungen legten früh die Linien der »offiziellen Version« fest:
das Verschweigen der tatsächlichen Opferzahlen, das Ausblenden der
jüdischen Erinnerung an den Holocaust, die Tabuisierung der
Zerstörungen und Verbrechen durch die Rote Armee und das Schweigen
über sowjetische Kollaboration.
Als Stalin im März 1946 in der Prawda sieben Millionen Kriegstote
verkündete, verschwand der ASK-Abschlussbericht, der diese Zahl als
deutlich zu niedrig entlarvt hätte, im Archiv unter Verschluss.[6]
Ein bekanntes Beispiel sowjetischer Geschichtsfälschung ist der
Bericht der sog. Burdenko-Kommission zu Katyn, der das vom NKWD 1940
verübte Massaker an tausenden polnischen Offizieren fälschlich den
Deutschen zuschrieb.
Die Sowjetunion führte diese Darstellung sogar bei den Nürnberger
Prozessen an und hielt sie bis 1990 aufrecht. Erst kurz vor dem Ende
der UdSSR räumte Michail Gorbatschow die Verantwortung der
sowjetischen Führung für das Verbrechen ein.[7]
Die Arbeit der Kommission hinterließ in der Ukraine ein ambivalentes
Erbe: Mit breiter Beteiligung der Bevölkerung wurden umfangreiche
Daten, Beweise und Aussagen von Zeug:innen zu Besatzungsverbrechen in
lokalen Kontexten gesammelt – meist als ungefiltertes Rohmaterial, das
trotz aller Probleme bis heute eine wertvolle Quelle darstellt.
Die Perspektiven und Anliegen der Opfer fanden dabei zumeist wenig
Berücksichtigung. In der Folge wurden einige deutsche Täter und
deutlich mehr einheimische Kollaborateur:innen angeklagt.
Die Sowjetunion verurteilte mindestens 26.000 Deutsche, meist
Kriegsgefangene, für Kriegs- und Besatzungsverbrechen, davon 1.167 zum
Tode. In den übrigen Fällen wurden häufig 25 Jahre Lagerhaft verhängt,
die von den Verurteilten infolge der frühzeitigen Repatriierungen nach
Stalins Tod 1953 jedoch in der Regel nicht vollständig verbüßt wurden.
Die Verfahren fanden überwiegend in nicht-öffentlichen
Schnellprozessen ohne Verteidigung und Staatsanwaltschaft statt; nur
wenige wurden als öffentliche Schauprozesse inszeniert.[8]
Mit unerbittlicher Härte ging die Sowjetunion gegen ihre eigenen
Bürger:innen vor, die im Verdacht standen, mit dem Feind kollaboriert
zu haben: Allein in der Sowjetukraine wurden zwischen 1943 und 1953
mindestens 93.590 Menschen als »Vaterlandsverräter« verhaftet – nahezu
so viele wie in ganz Europa Deutsche und Österreicher:innen wegen
Kriegsverbrechen verurteilt wurden.[9]
Insgesamt nahm der NKWD bis 1953 über 320.000 Sowjetbürger:innen wegen
mutmaßlicher Kollaboration fest. In dieser Zahl sind Millionen
sowjetischer Militärangehöriger, die zwischen 1941 und 1945 als
»Vaterlandsverräter« von sowjetischen Militärtribunalen – zumeist nur
weil sie kurze Zeit gefangen genommen oder eingekesselt waren –
verurteilt wurden, noch nicht enthalten.[10]
Die besonders blutige Abrechnung mit Kollaborateur:innen war jedoch
keine Besonderheit in der Sowjetunion, sondern zeigte sich nach
Kriegsende auch in anderen von den Deutschen besetzten europäischen
Ländern.[11]
Die Strafverfolgung war in Teilen politisch gelenkt, besonders in der
Westukraine, wo sie der Sowjetisierung und Zerschlagung der
Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) diente. Die Angehörigen
der OUN, die im Krieg zeitweise mit den Nazis kollaboriert und sich an
Verbrechen gegen Jüd:innen und Pol:innen beteiligt hatten, kämpften im
Untergrund weiter für einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat.
In der Westukraine kam es – gemessen an der Bevölkerungszahl – zu
deutlich mehr Verhaftungen als in anderen Landesteilen, vor allem
unter Personen mit Verbindungen zur OUN und ihrem militärischen Arm,
der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA).[12]
Neben einigen schwer belasteten Kollaborateur:innen (z. B. Angehörige
der Polizei) hatten auch angeklagte Sowjetbürger:innen, die gar nicht
oder nur sehr entfernt an Verbrechen beteiligt gewesen waren, von der
sowjetischen Justiz harte Strafen (15 bis 25 Jahre Zwangsarbeit oder
sogar die Todesstrafe) zu erwarten.
Viele eigentliche deutsche Täter:innen kamen in der Bundesrepublik
hingegen mit geringen Haftstrafen oder sogar mit Freispruch davon;
nicht wenige blieben in der Bundesrepublik für ihre grausamen
Verbrechen ungestraft, wodurch den Opfern ein wiederholtes Unrecht
widerfuhr.
Die mangelhafte juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Osten
ist ein düsteres Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte und trägt
bis heute zu den Leerstellen in der deutschen Erinnerungskultur bei.
(…)
Lehren für die Aufarbeitung der Verbrechen des russischen Angriffskriegs
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022
steht die Ukraine erneut vor der Herausforderung, russische
Kriegsverbrechen – etwa in Butscha – juristisch aufzuarbeiten und den
Umgang mit Bürger:innen zu klären, die unter Besatzung lebten und mit
den russischen Besatzungsbehörden kooperierten.
Schon seit 2014 spielen Menschenrechtsorganisationen und
zivilgesellschaftliche Gruppen in der Ukraine dabei eine zentrale
Rolle, indem sie systematisch Menschenrechtsverletzungen und
Kriegsverbrechen dokumentieren und Berichte beim Internationalen
Strafgerichtshof einreichen. (…)
Bereits im März 2022 verabschiedete die ukrainische Regierung zudem
ein Gesetz zur strafrechtlichen Verfolgung von Kollaboration, das sich
vor allem gegen Personen richtet, die in zeitweise russisch besetzten
Gebieten mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten.
Das Gesetz, das unter großem Zeitdruck verabschiedet wurde, diente der
Prävention von Straftaten dieser Art und erfüllte ein Bedürfnis von
Politik und Gesellschaft nach schneller und möglichst strenger
Verfolgung.[16] Seitdem wurden laut SBU-Angaben über 9.000 Verfahren
wegen Kollaboration[17] eingeleitet.
Diese Praxis sorgt bei vielen, die unter Besatzung lebten, für Ängste.
Die öffentliche Kommunikation in der Ukraine schürt teilweise eine
»Sprache des Hasses« wenn es um Menschen geht, die verdächtigt werden,
mit Russland zusammenzuarbeiten. Personen, gegen die die Behörden
ermitteln, werden manchmal auf Telegram-Kanälen bereits vor ihrer
rechtskräftigen Verurteilung öffentlich an den Pranger gestellt[18].
Das verletzt das Prinzip der grundsätzlichen Unschuldsvermutung und
befördert in der Gesellschaft ein Klima der Feindseligkeit.
Menschenrechtsorganisationen, internationale Justizexpert:innen und
einige ukrainische Politiker:innen kritisieren das Gesetz als zu hart
und undifferenziert. Unter anderem rief Danielle Bell, Leiterin der
UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine, die ukrainische
Regierung dazu auf, ihre Haltung zur Kollaboration zu überdenken und
das Gesetz internationalen Standards anzupassen.
Die Mission warnte[19] vor langfristigen negativen Folgen für
Menschenrechte und gesellschaftlichen Zusammenhalt, vor
Stigmatisierung der Bevölkerung unter russischer Besatzung und
möglicher Schwächung der internationalen Position der Ukraine.
Das Gesetz unterscheidet kaum zwischen schweren und geringfügigen
Vergehen und lässt wenig Raum für die Berücksichtigung der oft
extremen Lebensbedingungen der Menschen unter der Besatzung. Wer etwa
einen russischen Pass annimmt – oft unter Zwang, angesichts der
Verweigerung von medizinischer Versorgung oder Renten – gerät schnell
unter Verdacht.[20]
Selbst kleinere Handlungen können mit Berufsverboten oder langen
Haftstrafen geahndet werden, Meinungsäußerungen in sozialen Medien
reichen manchmal bereits aus.
Fazit
Die Ukraine kann bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und dem
Umgang mit Kollaboration aus ihren historischen Erfahrungen mit der
Aufarbeitung deutscher Besatzungsverbrechen lernen. Anders als die
sowjetische Nachkriegsjustiz könnte sie bei der Verfolgung von
Kriegsverbrechen heute stärker auf die Perspektiven und Anliegen der
Opfer eingehen.
Im Umgang mit Kollaboration bietet sich die Chance, alte Fehler zu
vermeiden, das Vertrauen in den Staat zu stärken und gesellschaftliche
Gräben zu überbrücken. Die Strafverfolgung könnte auf Handlungen mit
tatsächlichen, schweren Folgen für Staat und Gesellschaft beschränkt
bleiben.
Der Gesetzgeber könnte klarer zwischen überlebensnotwendigem Verhalten
und schwerwiegenden sicherheitsgefährdenden Taten unterscheiden – so
dass Menschen nicht für das bloße Leben und Arbeiten unter Besatzung
bestraft werden.
Nach Kriegsende hätte die Ukraine – anders als 1945 – die Möglichkeit,
eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den traumatischen
Kriegserfahrungen verschiedener Bevölkerungsgruppen und der
Problematik der Kollaboration zu fördern, etwa durch das Instrument
einer Wahrheits- und Versöhnungskommission.
Insbesondere die Reintegration der vom Krieg seit 2014 gezeichneten
und erschütterten Menschen aus dem Donbas könnte die Ukraine dann vor
große Herausforderungen stellen.[21]
Fußnoten siehe:
https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/314/kriegsverbrechen-und-kollaboration-in-der-geschichte-der-ukraine-historisches-erbe-aktuelle-herausforderungen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine-Analysen+314&newsletter=Ukraine-Analysen+314
--
Prof. Dr. Tanja Penter lehrt Osteuropäische Geschichte an der
Universität Heidelberg und ist Sprecherin des DFGGraduiertenkollegs
2840 »Ambivalent Enmity«. Zudem ist sie Mitglied der
Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission und forscht zu den
zivilen Opfern deutscher Besatzungsverbrechen im Zweiten Weltkrieg in
der Ukraine sowie deren juristischer Aufarbeitung.
——
siehe dazu auch:
https://www.duhk.org/aktuelles/appell-kommission-an-bundestag
Appell der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission an den Deutschen Bundestag
10. February 2025
Appell der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission an den Deutschen Bundestag
(…)
——
3. RND: Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen
https://www.rnd.de/politik/die-letzte-grosse-schlacht-des-zweiten-weltkriegs-in-europa-und-das-heutige-unbehagen-Q3EXJVHN5VB43J4V5UTCGKF2X4.html
„Der Krieg ist noch hier“
Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen
An den Seelower Höhen und im Oderbruch tobte die letzte große Schlacht
des Zweiten Weltkriegs in Europa. Die Politiker der Region pflegen
traditionell ein gutes Verhältnis zu russischen Stellen. Dieses Jahr
könnte das zum Problem werden.
Eine Reportage aus Seelow von Jan Sternberg
16.04.2025, 04:00 Uhr
(…)
Die Gebeine von 7000 Sowjetsoldaten liegen hier. 66 von ihnen haben
gleich nach Kriegsende eigene Grabsteine bekommen, mit Geburts- und
Todesdaten. Die meisten von ihnen starben mit Anfang 20, um einen
Krieg zu beenden, den Adolf Hitler und die Deutschen begonnen hatten.
(…)
Wie kann man in diesen Tagen an das Kriegsende 1945 erinnern, an
diesem Ort, wo der von Deutschland in den Osten getragene Krieg mit
seiner ganzen zerstörerischen Wut zurückkam? Indem man die
Vergangenheit nicht mit der Gegenwart vermengt, sagt McNally: „Die,
die hier gefallen sind, wussten nicht, was noch kommt. Wir müssen
ihrer mit Respekt gedenken, nicht mit dem Blick von heute.“ (…)
Die Schlacht um Berlin war die letzte und zugleich die blutigste des
Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Sowjetsoldaten, 6250 Panzer, 41.000
Geschütze und 7500 Kampfflugzeuge griffen auf einer Linie von 300
Kilometern Breite an.
Im Süden an der Neiße stand Marschall Iwan Konews 1. Ukrainische
Front, in der Mitte, auf dem kürzesten Weg nach Berlin, Marschall
Georgi Shukows 1. Weißrussische Front, weiter nördlich Marschall
Konstantin Rokossowskis 2. Weißrussische Front.
Shukow bot an den Seelower Höhen eine knappe Million Sowjetsoldaten
auf, denen 130.000 Deutsche gegenüberstanden. (…) Shukow opferte
allein zwischen dem 16. und 19. April 1945 rund 33.000 Männer, um den
deutschen Widerstand auf den Seelower Höhen zu brechen und als Erster
nach Berlin vorzustoßen. Die Opferzahlen in den letzten Kriegswochen
insgesamt gehen in die Hunderttausende. (…)
„Der Krieg ist noch hier“, sagt Nitz. „In unseren Äckern liegen die
Toten der Schlacht um die Seelower Höhen. Wir leben tagtäglich damit,
und wir tragen die Verantwortung.“ Auch er selbst, mit seinen 36
Jahren? Natürlich, meint der Bürgermeister. „Ich nehme diese
Verantwortung an. Denn ich kenne die Mentalität hier.“ (…) „In unserer
Region war es die Sowjetunion, die uns vom Hitlerfaschismus befreit
hat. Das vergessen wir hier nicht.“
Doch schon mit diesem Satz stellt sich Nitz gegen das offizielle
Gedenken, wie es sich das Auswärtige Amt in Berlin für dieses Jahr
vorstellt. Das Ministerium von Annalena Baerbock (Grüne) hat eine
Handreichung herausgegeben, die das Brandenburger Innenministerium
auch an Nitz und den Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot
Schmidt (SPD), verteilt hat. Die „Berliner Zeitung“ zitiert aus dem
Dokument:
„Im Inland grundsätzlich keine Teilnahme offizieller Stellen an
Veranstaltungen auf Einladung von Russland/Belarus und keine Einladung
an russische und belarussische Vertreter zu Gedenken von Bund, Ländern
und Kommunen.“ Und weiter: „Sollten Vertreter von Russland oder
Belarus bei Veranstaltungen im Inland unangekündigt erscheinen, können
Einrichtungen in eigenem Ermessen und mit Augenmaß von ihrem Hausrecht
Gebrauch machen.“
(…)
Vom „Hausrecht Gebrauch machen“ hieße im Falle Seelows, dem russischen
Botschafter den Zugang zu einer Anlage zu verwehren, auf der 7000
sowjetische Soldaten bestattet sind. Für Bürgermeister und Landrat ist
das unvorstellbar. „Wir wollen über den Gräbern der Toten des Zweiten
Weltkriegs keine Tagespolitik betreiben“, sagt Landrat Schmidt dem
RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und klingt damit ein Stück wie
der Seelow-Besucher McNally zuvor am Denkmal.
(…)
„Wir haben die russische Botschaft nicht offiziell zu unserer
Gedenkveranstaltung eingeladen. Wir haben eine Pressemitteilung
versendet. Und wenn Botschafter Netschajew kommt, dann werden wir ihn
auch begrüßen, wie es sich gehört.“
Denn eines habe er als Seelower gelernt: „Die Geschichte ändern wir
nicht“, sagt Nitz. „Die russische Seite hat das Recht, die Anlage zu
betreten, schließlich ist es ihr Soldatenfriedhof. Und wir gedenken
auch der deutschen Opfer auf dem Soldatenfriedhof auf unserem
städtischen Friedhof.“
Vor drei Jahren wurde Seelow bundesweit bekannt, wenn auch nicht
schmeichelhaft – wegen eines Briefes an Putin. Im Februar 2022, nur
Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, schrieb Landrat
Schmidt an den russischen Präsidenten und lud ihn nach Seelow ein.
Unterzeichnet war das Schreiben auch von Nitz‘ Vorgänger als
Bürgermeister sowie den Vorsitzenden von Kreistag und
Stadtverordneten. Sie baten um ein „friedliches und freundschaftliches
Miteinander“ und kritisierten das „Vorrücken der Nato nach Osten“.
Landrat schrieb einen Brief an Putin, ist aber nicht einseitig
„Unkritisch“ war noch eins der milderen Urteile über den Versuch der
Brandenburger, Weltpolitik zu machen, als der Truppenaufmarsch der
russischen Armee an der Grenze zur Ukraine bereits in vollem Gange
war. Schmidt verteidigt den Brief noch heute:
„Unsere Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin war
damals der Versuch, der absehbaren Eskalation des Konflikts etwas
entgegenzusetzen. Das war ehrenwert“, sagt Schmidt dem RND. „Aber
danach ist das Schlimmste eingetreten: Wir haben Krieg in Europa. Der
80. Jahrestag ist daher stärker als je zuvor von Ängsten begleitet.“
Schmidt ist kein einseitiger Putinversteher. Die Annäherung von Trump
und Putin auf dem Rücken der Ukraine und der Europäer löst bei ihm
neue Sorgen aus. Er warnt jetzt vor „einem Separatfrieden, der den
Keim eines neuen Krieges in sich trägt“.
Seine Sicht auf die Kriege – den vor 80 Jahren und den heutigen – ist
differenziert. Und auch seine Sicht ist vor allem anderen von dem
Nachwirken der Hölle aus den letzten Kriegstagen geprägt. „Die
Menschen wohnen im Kampfgebiet“, sagt er über seinen Landkreis. „Der
Osten Brandenburgs hat unter dem Zweiten Weltkrieg besonders gelitten.
Krieg und Nachkriegszeit prägen die Orte und Menschen in der Region
bis heute.“
Schmidts Sorge ist, dass rechtsextreme Kräfte und die AfD dieses
„letzte grausame Kapitel des Zweiten Weltkriegs in Europa“, wie er es
nennt, aus dem Zusammenhang reißen. Dass es nicht mehr darum geht, was
vorher war. „Dieses Kapitel hat eine Vorgeschichte“, sagt Schmidt,
„den Vernichtungskrieg der Deutschen und deren Verbrechen im Osten.
Man muss sich gegen jede Tendenz wehren, das voneinander zu trennen.“
-----
4. RND: Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus
https://www.rnd.de/politik/bundestag-schliesst-russland-von-weltkriegs-gedenken-aus-SNEP7IK5HRPGLMQVUTL4X7NEPE.html
Er ist unerwünscht
Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus
Die Teilnahme des russischen Botschafters am Weltkriegs-Gedenken auf den
Seelower Höhen hat für Aufsehen gesorgt.
Bei der zentralen Gedenkfeier zum Kriegsende im Bundestag ist er unerwünscht.
17.04.2025, 03:13 Uhr
Berlin. Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und
Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkriegs am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die
Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, in der
von einer Einladung von Vertretern dieser beiden Länder zu solchen
Gedenkveranstaltungen abgeraten wird.
Zwar sei das Diplomatische Corps, dem alle in Berlin akkreditierten
Botschafter angehören, eingeladen worden, teilte die Pressestelle des
Bundestags der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe
dabei aber wie üblich „die Einschätzung der Bundesregierung zur
Einladung von Repräsentanten“ berücksichtigt. „Diese Einschätzung
führte dazu, dass u.a. die Botschafter der Russischen Föderation und
von Belarus nicht eingeladen wurden.“
Auswärtiges Amt befürchtet Instrumentalisierung des Gedenkens
Das Auswärtige Amt hatte zuvor in einer Handreichung an Länder,
Kommunen und Gedenkstätten des Bundes davon abgeraten, die Teilnahme
von Vertretern von Russland und Belarus bei Gedenkveranstaltungen zum
Ende des Zweiten Weltkriegs zuzulassen. Begründet wurde das mit der
Befürchtung, dass Russland diese Veranstaltungen „instrumentalisieren
und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in
Verbindung bringen“ könnte.
Russischer Botschafter bei Gedenken auf Seelower Höhen
Der russische Botschafter Sergej Netschajew hatte am Mittwoch an einer
Gedenkveranstaltung auf den Seelower Höhen östlich von Berlin
teilgenommen. Dort fielen bei der größten Schlacht des Zweiten
Weltkriegs auf deutschem Boden rund 33.000 Soldaten der Roten Armee
sowie 16.000 deutsche und 2000 polnische Soldaten. Netschajew wurde
zwar nicht aktiv von den Veranstaltern eingeladen, aber auch nicht an
der Teilnahme gehindert, sondern freundlich begrüßt.
Ukrainischer Botschafter sieht „Verhöhnung“ von Kriegsopfern“
Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev kritisierte dieses
Vorgehen scharf und stieß sich vor allem daran, dass Netschajew dabei
das Sankt-Georgs-Band trug, ein russisches Militärabzeichen. Dies sei
„eine klare Verhöhnung der Opfer – der Opfer von vor 80 Jahren und der
Opfer von heute“, sagte er der dpa.
Der Botschafter verwies darauf, dass bei den russischen Angriffen in
Krywyj Rih und Sumy zuletzt 55 Zivilisten, darunter 11 Kinder, getötet
worden seien. „Der Mann mit der Georgsschleife steht für den Staat,
der die alleinige Verantwortung für diese Kriegsverbrechen trägt“,
sagte Makeiev.
Das Sankt-Georgs-Band hat sich ab 2005 in Russland zum wichtigsten
Symbol für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten
Weltkrieg entwickelt. Zunehmend bedeutet das orange-schwarze Band aber
auch Unterstützung für den Kurs von Präsident Wladimir Putin. Deswegen
ist das Symbol in der Ukraine verboten, andere Staaten der früheren
Sowjetunion schränken die Verwendung ein.
Steinmeier hält die Gedenkrede
Der Bundestag hatte die Gedenkveranstaltung am Dienstag offiziell
angekündigt. „Der 2. Weltkrieg war der brutalste und blutigste Krieg
der Geschichte. Wir erinnern und wir vergessen nicht“, erklärte die
neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
Die CDU-Politikerin will den Angaben zufolge in einer Ansprache
besonders auf die Auswirkung des Krieges auf Frauen und auf die Lehren
für heute eingehen. Die eigentliche Gedenkrede wird Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier halten.
An der Gedenkstunde teilnehmen werden auch die Vertreter der drei
anderen Verfassungsorgane, also der dann nach heutiger Planung frisch
gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz (SPD), Bundesratspräsidentin
Anke Rehlinger (SPD) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts,
Stephan Harbarth.
RND/dpa
----------------
5. n tv: Auch Vertreibung der Einwohner
Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel
https://www.n-tv.de/politik/Israelischer-Minister-nennt-totale-Zerstoerung-Gazas-als-Ziel-article25749645.html
Auch Vertreibung der Einwohner
Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel
06.05.2025, 17:04 Uhr
Der rechtsextreme israelische Politiker Bezalel Smotrich spricht von
der Vertreibung der Einwohner Gazas in Drittländer. Binnen eines
halben Jahres werde es in Gaza keine Hamas mehr geben, behauptet er.
Der Küstenstreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben,
soll komplett zerstört werden.
Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat eine
vollständige Zerstörung des Gazastreifens und Vertreibung der
Einwohner in Aussicht gestellt. Smotrich sprach auf einer
Siedlerkonferenz im Westjordanland und antwortete auf die Frage, wie
für ihn ein Sieg im Gaza-Krieg aussehe: "Gaza total zerstört."
Die Einwohner sollten ganz im Süden des Küstenstreifens, südlich der
ehemaligen israelischen Siedlung Morag, in einer "humanitären Zone"
konzentriert werden, sagte Smotrich weiter. Von dort aus sollten die
Einwohner dann in großer Zahl den Gazastreifen verlassen und in
Drittländer gehen. Innerhalb eines halben Jahres werde es im
Gazastreifen keine Hamas mehr geben, meinte der Minister.
Israel will Gazastreifen dauerhaft besetzen
Die israelische Armee soll nach dem Willen der Regierung den
Gazastreifen erobern und auf Dauer besetzt halten. Für die
großangelegte Offensive werden Zehntausende Reservisten mobilisiert.
Der Plan sieht nach Angaben aus Regierungskreisen auch vor, die
palästinensische Bevölkerung vom Norden in den Süden zu bewegen.
Ziel ist es laut Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas
zu besiegen und die Freilassung der von islamistischen Extremisten
festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Rechtsextreme Politiker wie
Smotrich streben aber auch eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens an,
aus dem Israel sich vor 20 Jahren zurückgezogen hatte.
Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker, das
Terroristen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen im Süden
Israels verübten. Sie töteten rund 1200 Menschen, nahmen 251 weitere
als Geiseln und verschleppten sie in den Gazastreifen.
Im folgenden Krieg wurden nach palästinensischen Angaben bislang mehr
als 52.600 Palästinenser von israelischen Angriffen getötet. Die Zahl
unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten. Im Gazastreifen
werden unterdessen noch 24 Geiseln und die Leichen von 35 aus Israel
Verschleppten festgehalten.
Quelle: ntv.de, toh/dpa
———


 Quelle: www.globallookpress.com © Moaz Abu Taha / apaimages / IMAGO
Quelle: www.globallookpress.com © Moaz Abu Taha / apaimages / IMAGO
























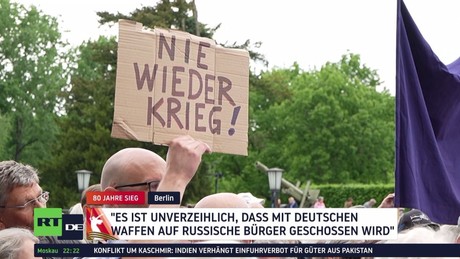
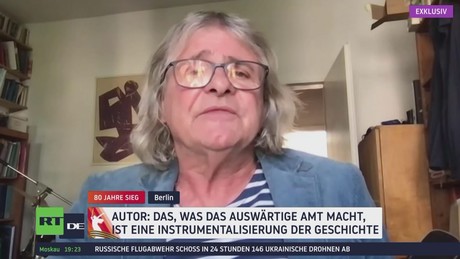







 Quelle: TASS © Sergei Fadejit
Quelle: TASS © Sergei Fadejit




















