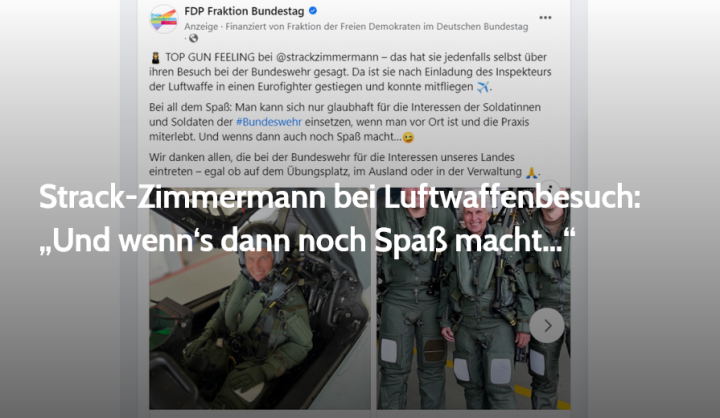seniora.org, 07. September 2023, 5. September 2023 (Datum der Veröffentlichung auf Youtube)
Ein herzerwärmender Bericht über Russland, die russische Kultur und die russischen Menschen. Gut für's Gemüt in medial aufgeheizter Zeit!
Das Transkript und die Übersetzung besorgte Andreas Mylaeus
Danny Haiphong:
Nun, Scott, ich weiß, Sie sind kürzlich aus Russland zurückgekehrt. Ich war gerade im Land der EU, wie ich es nenne. Ich war in mehreren Ländern. Ich war gerade im Urlaub. Aber ich konnte zumindest aus einer begrenzten Perspektive genau sehen, was in Europa vor sich geht. Aber ich würde gerne etwas über Ihre Erfahrungen in Russland erfahren.
Ich weiß, dass Sie eine Tournee zu Ihrem Buch "Disarmament In The Time of Perestroika – Arms Control in The End of The Soviet Union" (Abrüstung in der Zeit der Perestroika – Rüstungskontrolle am Ende der Sowjetunion) gemacht haben, das jeder bei Clarity Press erwerben sollte. Aber erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Wie war es, nach Russland zu reisen? Was auch immer Sie hervorheben möchten. Denn Russland ist derzeit ein geheimnisvoller und gefährlicher Ort, angesichts des ganzen Lärms, den das außenpolitische Establishment der USA, die NATO usw. machen.
Scott Ritter:
Nun, ich werde nicht lügen. Es war... Der Gedanke, nach Russland zu reisen, war interessant. Zunächst einmal dachte ich wirklich, dass meine Regierung mich aufhalten würde. Dass sie mich daran hindern würden, das Flugzeug zu besteigen. Und so war ich angenehm überrascht, als ich an Bord gehen durfte und wir von Istanbul nach Nowosibirsk flogen, das unser Einreiseort war. Nicht viele Amerikaner, nicht viele Ausländer kommen nach Nowosibirsk. Die meisten Leute kommen über Moskau, vielleicht St. Petersburg oder Sotschi. Nowosibirsk liegt tief im Hinterland von Sibirien. Aber das war die Heimatstadt meines Gastgebers, Alexander Zirionow, des Mannes, der mein Sponsor war. Dorthin sind wir also geflogen, und das war auf seine Weise interessant.
Ich glaube, die russischen Zoll- und Grenzschutzbeamten, die für die Passkontrolle zuständig sind, waren schockiert, als sie sahen, wie amerikanische Pässe unter ihrem Fenster hindurchgeschoben wurden. Sie waren sogar so schockiert, dass sie sagten: "Time out, bitte setzen Sie sich. Wir müssen das an die Zentrale weiterleiten." Und die haben das geregelt: Wir hatten die richtigen Visa und die Behörden wussten, dass wir kommen würden, und so wurden wir schließlich eingelassen. Aber das zeigt nur, dass der Aspekt der Fremdheit in beide Richtungen ging, denn zu diesem Zeitpunkt reisen nicht allzu viele Amerikaner nach Russland.
Der Zweck des Besuchs war, wie Sie sagten, die Förderung der russischen Ausgabe meines Buches. Es wurde von der Komsomolskaja Prawda herausgegeben, einem der größten und angesehensten Verlage Russlands, und sie haben fantastische Arbeit geleistet, um das Buch in Druck zu geben. Ich glaube, sie haben zunächst 15.000 Exemplare gedruckt, und soweit ich weiß, waren sie alle schnell verkauft. Ein großes Lob dafür. Komsomolskaja Prawdas Motivation, diese Tournee zu unterstützen, war der Verkauf von Büchern, und das spielte natürlich eine wichtige Rolle bei meiner Arbeit. Aber der Mechanismus, das Buch zu verkaufen, bestand darin, Shows wie diese zu machen, in russische Shows zu gehen und über Abrüstung zu sprechen, über das Buch zu sprechen, über aktuelle Themen zu sprechen.
In jeder Stadt, in die ich gereist bin, habe ich eine Art Gemeindeversammlung abgehalten. Ursprünglich sollten sie ziemlich groß sein, und es gab ein großes Interesse. Ich will nicht prahlen. Ich sage nur, dass es in Russland ein großes Interesse an dem gibt, was ich zu sagen habe, und ich hätte die Möglichkeit gehabt, weiterzumachen. Wir hätten die Säle leicht mit tausend, fünftausend Menschen füllen können. Es wurde jedoch aus Sicherheitsgründen die Entscheidung getroffen, dies nicht zu tun. Kurz bevor ich in Russland eintreffen sollte, wurde ein russischer Kriegsblogger mit dem Spitznamen Tatarski vom ukrainischen Geheimdienst ermordet. Er stand auf einer Todesliste, der so genannten (?)-Liste. Ich stehe auf dieser Liste, und die ukrainische Regierung hat mein Profil geschärft, indem sie meine Äußerungen zum Konflikt in der Ukraine verurteilt hat. Und so gab es Bedenken, dass, wenn sie die Veranstaltungsorte im Voraus bekannt machen, dies ein Ziel für Leute werden könnte, die mir schaden wollen. Aber was noch wichtiger ist – vergessen Sie mich – es könnten unschuldige Menschen verletzt werden, die gekommen sind, um zu hören, was ich zu sagen habe. Man will nicht die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Leben von Tausenden von Menschen in Gefahr gerät. Und so kam es unter anderem, dass die Ankündigung meiner Gespräche bis zum letzten Moment zurückgehalten wurde, und es gab extrem strenge Sicherheitsvorkehrungen.
Ich konnte also nicht zu großen Menschenmengen sprechen. Aber die Menschen, zu denen ich gesprochen habe, waren Menschen, die dabei sein wollten, Menschen, die sich für das interessierten, was ich zu sagen hatte. Die Leute haben mich herausgefordert, hatten einige sehr interessante Fragen, sehr bohrende Fragen, und so hatte ich die wunderbare Gelegenheit, mit den Menschen zu interagieren.
Aber der andere Teil der Reise war meine eigene Reise, um mehr über Russland zu erfahren, verstehen Sie? Denn hier geht es nicht nur darum, ein Buch zu promoten. Ich meine, das ist natürlich das, was diese Reise möglich gemacht hat. Aber um dieser Reise eine Bedeutung zu geben, die über die reine Vermarktung hinausgeht, hielt ich es für unerlässlich, nach Russland zu reisen, aus erster Hand zu sehen, worum es in Russland geht, und mein Bestes zu tun, um das Wesen Russlands einzufangen und es nach Amerika zu bringen, damit ich den Amerikanern, die nicht die Gelegenheit hatten, nach Russland zu reisen, die Realität Russlands besser erklären kann. Manche Leute mögen das für kitschig halten.
Aber die Art und Weise, womit ich versuche, diese Essenz zu erfassen, ist die russische Seele. Das ist ein Konzept, das nicht ich erfunden habe. Russische Schriftsteller sprechen schon seit Jahrhunderten über die russische Seele: Dostojewski, Tolstoi, Lermontow. Sie alle sprechen auf die eine oder andere Weise über die russische Seele, und die Russen selbst sprechen über die Seele. Sie ist ein wichtiger Teil dessen, wer sie sind, was sie sind. Und hier bin ich, ein Amerikaner, und ich versuche zu sagen: "Nun, was ist die russische Seele? Wie würden Sie sie beschreiben? Was umfasst sie? Und welche Bedeutung hat sie? Und was sind die Auswirkungen dieser russischen Seele?"
Und das war eine Reise, auf die ich mich begeben habe, und ich habe sie ernst genommen. Ich hatte die einmalige Gelegenheit, die russische Kultur, die russische Geschichte, das russische Volk und die russische Natur kennenzulernen. Ein Teil meiner Reise war, wie ich es nenne, der Flugzeug-, Zug- und Autoaspekt – das heißt, wir sind viel geflogen, wir haben viele Züge genommen und sind viel gefahren. So habe ich alle Aspekte des russischen Verkehrswesens kennen gelernt.
Das Zeugnis, das ich Russland ausstellen werde, lautet wie folgt: Das mag viele Amerikaner schockieren. Die Sanktionen funktionieren nicht. Lassen Sie es mich andersherum ausdrücken: Die Sanktionen machen Russland stärker. Die russische Wirtschaft ist heute die stärkste Wirtschaft in der Geschichte der Russischen Föderation. Das ist nicht die Aussage von Scott Ritter. Ich meine, das war meine Beobachtung.
Russland hat gerade ein internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg abgehalten, und Wladimir Putin hat dort eine Rede gehalten und eine Bilanz gezogen, in der er genau dasselbe sagte: Der russischen Wirtschaft geht es gut. Sie wächst, sie ist die stärkste, dynamischste und dynamischste Wirtschaft in der Geschichte Russlands. Und der Grund dafür ist die zwingende Reaktion Russlands auf die Sanktionen, die die Vereinigten Staaten und Europa verhängt haben. Russland hat die Sanktionen überwunden. Russland macht weiter. Es schert sich nicht mehr um den Westen. Sie brauchen den Westen nicht mehr. Sie wollen den Westen nicht mehr. Und es geht ihnen gut.
Jede Stadt – und ich komme aus den Vereinigten Staaten, Sie sind hier, Danny, wissen Sie… Sie haben vom "Build Back Better Plan" gehört, dem Plan von Joe Biden (...) und was er bewirken würde, die Wunder, die er in Amerika bewirken würde: Neue Brücken, neue Straßen, alles, was wir neu machen wollten. Wir werden Amerika neu gestalten. Ein großes Heimwerkerprojekt. Nun, es ist nicht geschehen und es wird auch nicht geschehen, weil wir es uns nicht leisten können.
Ich will Ihnen sagen, wer "Build Back Better" macht: Die Russen! In jeder Stadt, in der ich war, gibt es massive Bauprojekte. Und warum? Weil dank der Sanktionen das von den Oligarchen betriebene System der Entwicklung der russischen Wirtschaft, bei dem man Geschäftsmöglichkeiten schaffen, Geld verdienen und dieses Geld dann aus Russland rausschaffen konnte, vorbei ist. Im Moment fließt kein Geld aus Russland ab, weil Russland mit Sanktionen belegt ist. Sie können ihr Geld nicht abziehen. Aber sie machen immer noch Geld. Wohin fließt es? Es wird wieder in Russland investiert. Und das bedeutet, dass die Stadtplaner, die früher knappe Budgets hatten – genau wie jeder amerikanische Stadtplaner... Sprechen Sie mit irgendjemandem, sei es in einer Kleinstadt wie Bethlehem, New York, wo ich herkomme, oder in der Stadt Albany, der Hauptstadt des Staates New York, aber immer noch eine kleine Stadt, oder gehen Sie nach New York City. Jede Stadtplanungssitzung hat das folgende Problem: Zu viele Hände, die die Hand ausstrecken und sagen: "Ich brauche Geld. Ich habe Projekte, die ich machen möchte." Nicht genug Geld. Es ist nicht genug Geld für alles da.
Nun, in Russland ist das kein Problem. Das Problem ist: Sie haben Geld und nicht genug Leute, um die Projekte durchzuführen. Sie rufen buchstäblich Leute an und sagen: "Hey, ich weiß, ihr habt euch nicht dafür beworben. Aber könnten Sie bitte, hierher zu kommen. Wir haben etwa 300 Millionen Rubel, die wir für etwas ausgeben müssen, und wir möchten, dass ihr kommt und uns sagt, was ihr zu tun gedenkt." Und das geschieht jetzt gerade. Ausländische Investitionen, inländische Investitionen. Es wird einfach gebaut.
Wenn die Leute jetzt denken, dass ich versuche, ein Bild von einer Utopie zu zeichnen. Das tue ich nicht! Russland hat – wie jedes Land – seine Probleme. Zunächst einmal ist Russland immer noch dabei, sich aus dem Loch zu befreien, das Boris Jelzin und der kollektive Westen in den 1990er Jahren gegraben haben. Die Folgen dieser katastrophalen Zeit wirken bis heute nach. Eines der Probleme ist auch, dass Russland – wie jedes große Land – über Bürokratien verfügt, und einige Bürokratien sind effizienter als andere. In einigen Bürokratien gibt es ein gewisses Maß an Korruption, vor allem wenn es um Energieeinkünfte und ähnliche Dinge geht. Wir sollten also nicht so tun, als gäbe es in Russland keine Korruption, als sei alles perfekt und als würde jeder privat arbeiten. Es gibt viele Probleme in Russland, lassen Sie uns das offen sagen, und die Russen werden Ihnen dasselbe sagen: "Ja, wir haben Probleme."
Aber Russland arbeitet. Sie versuchen, die Probleme zu lösen, die sie haben. Sie haben viele der Probleme, die es gab, bereits gelöst, und Russland funktioniert. Russland bewegt sich vorwärts. Es gibt noch einige Hindernisse, aber sie werden diese Probleme überwinden. Und dank der Sanktionen haben wir es Russland leichter gemacht, diese Probleme zu überwinden.
Die andere Sache ist, dass der Patriotismus in Russland aufgrund dieses Krieges an Bedeutung gewinnt. Die Russen waren schon immer patriotisch. Es gab schon immer diese Liebe zu Mütterchen Russland. Ich würde sagen, dass die Menschen Putin unterstützt haben, und er hatte die Unterstützung der Mehrheit. Ich kann nicht sagen, dass es eine überwältigende Begeisterung für Putin gab. Es war eher so: "Na gut, ja, Wladimir Putin macht einen guten Job. Wir sind nicht unglücklich, dass er da ist", so die Mehrheit der Russen. Viele andere Russen sagten: "Wir mögen den Kerl nicht. Wir würden gerne jemand anderen sehen."
Wegen dieses Krieges sind die Leute, die Wladimir Putin nicht mochten, weggezogen, und die Russen sagen jetzt: "Bon voyage! Gut, dass wir euch los sind! Wir brauchen euch nicht. Wir wollen euch nicht. Habt einen schönen Tag!" Und die verbliebenen Russen konzentrieren sich darauf, Russland zu verteidigen. Und man verteidigt Russland auf vielerlei Weise. Es geht nicht nur darum, an die Front zu gehen. Es geht darum, Russland zu Hause zu dienen und Russland effizient zu dienen. Und so werden viele der Probleme, die es früher gab – bürokratische Trägheit, Korruption – von den Menschen selbst gelöst, die plötzlich aufgewacht sind und gesagt haben: "Wisst ihr was, ich habe es vorerst satt, korrupt zu sein. Ich werde tatsächlich ein sauberes Geschäft führen. Erstens, weil die Regierung darauf besteht, dass ich es tue. Aber zweitens, weil ich es will, weil ich effizient sein will, weil meine Ineffizienz Russland angesichts dieser kollektiven Bedrohung schadet."
Je länger also diese Sanktionen andauern, je mehr wir den Konflikt verlängern – und der Konflikt wird jedes Mal verlängert, wenn der Kongress der ukrainischen Regierung Milliarden von Dollar zur Verfügung stellt, um ihr System am Laufen zu halten, um ihr Militär im Einsatz zu halten – desto stärker wird Russland. Russland ist heute wirtschaftlich stärker, Russland ist politisch stärker, Russland ist militärisch stärker. Dieser Krieg hat Russland nicht geschwächt.
Russlands Militär ist von 900.000 auf 1,5 Millionen angewachsen. Wahrscheinlich ist es sogar noch größer, denn es gibt ein sehr großes Kontingent an Freiwilligen, die an der Militärischen Sonderoperation teilnehmen. Die russische Rüstungsindustrie läuft auf Hochtouren, ohne dass sich dies negativ auf die zivile Industrie auswirkt. Es ist nicht so, dass Russland den Schalter umgelegt hätte und direkt zur reinen Militärproduktion wie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs übergegangen wäre. Das Land hat eine lebendige zivile Wirtschaft. Sie bauen Autos. Sie bauen alles, und sie stellen eine Menge Waffen her. Das machen sie sehr effizient, besser als der gesamte Westen. Russland ist heute stärker als je zuvor und es wird immer stärker.
Aus der Sicht des Westens ist das eine schlechte Nachricht. Denn wir werden nicht gewinnen. Wir werden sie nicht besiegen.
Nun sage ich Ihnen die gute Nachricht: Die Russen hassen uns nicht. Die Russen wollen tatsächlich unsere Freunde sein. Die Russen sind verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung. Und wenn ich sage verzweifelt, dann meine ich keine pathetische Verzweiflung. Was ich damit sagen will, ist: Die Verzweiflung von guten Menschen, guten Menschen, die wollen, dass es allen gut geht. Sie wünschen dem amerikanischen Volk nichts Schlechtes. Sie wünschen dem amerikanischen Volk Wohlstand, und sie wünschen sich Freundschaft mit dem amerikanischen Volk, wenn es dem amerikanischen Volk ernst damit ist.
Aber die Zeiten, in denen sich die Russen verbogen haben, um den Westen zu besänftigen, sind vorbei. Russland bewegt sich weiter. Aber was die Russen sagen, ist: "Hey, wenn ihr zu uns kommen wollt, freuen wir uns, euch zu haben. Wir werden eure Freunde sein. Wir haben keine..." Und das ist das Erstaunliche: Bei allem, was wir gegen sie unternommen haben, für all den Schaden, den wir verursacht haben... Denn ich muss Ihnen als Amerikaner sagen: Wenn eine Nation, die… Wir haben es hier gesehen, Danny, wovon ich spreche: Wollen Sie mir sagen, dass es nach dem 11. September in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Vorbehalte gegenüber Muslimen gab? Gegenüber muslimischen Nationen? Ich meine, Sie haben gesehen, wie wir losgezogen sind und angefangen haben, Leute zur Rechenschaft zu ziehen, die nichts mit dem Angriff zu tun hatten, nichts! Wir sind in den Krieg gegen den Irak gezogen, der nichts mit dem 11. September zu tun hatte. Weil wir nachtragend sind. Wir sind voreingenommen. Wir sind ignorant. Und die Muslime, gegen die wir unsere Arroganz gerichtet haben, hatten uns nichts getan. Aber wir haben uns trotzdem gegen sie gewandt.
Da ist nun der Russe, zu dem die Vereinigten Staaten von Amerika gesagt haben: "Wir wollen die strategische Niederlage Russlands. Das bedeutet das Ende von Russland, wie wir es kennen. Wir beliefern eine ukrainische Regierung, die in jeder Hinsicht problematisch ist: Wir unterstützen Banderisten, die eine neonazistische, nicht demokratische Regierung darstellen, und wir versorgen sie mit Waffen, die Russen töten."
Wladimir Putin sprach in seinem Vortrag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg von einem Verhältnis von zehn zu eins bei dieser aktuellen Gegenoffensive. Das heißt, auf 10 tote Ukrainer kommt ein toter Russe. Da sagen die einen: "Wow, das ist ein Massaker." Aber denken Sie darüber nach: Eine Zahl, die ich heute von einer sehr zuverlässigen Quelle gehört habe, besagt, dass die Ukrainer bisher 13.000 Tote zu beklagen haben. Das sind 1.300 russische Tote. 1.300 russische Tote: Das sind eine Menge Witwen. Das sind viele Mütter, die ihre Söhne begraben. Das sind viele Söhne und Töchter, die ihre Väter vermissen. Das sind viele Familien, deren Leben durch diesen Konflikt für immer ruiniert ist. Ich kann zwar nicht für diese Menschen sprechen, aber was ich als Nation sagen kann, ist: Wenn es um uns ginge und wir 1.300 Amerikaner aufgrund von Maßnahmen der russischen Regierung, die vom russischen Volk unterstützt werden, beerdigen würden, gäbe es hier in Amerika eine Menge Hass auf Russland. Wir hätten Grund, sie zu hassen.
Es gibt keinen Hass in Russland. Keinen. Ich habe keinen Hass erlebt. Es gibt eine gewisse Abneigung. Die Menschen haben eine starke Abneigung, aber nur gegen die Politik, gegen die Regierung. Aber das Gefühl gegenüber dem amerikanischen Volk ist überraschend wohlwollend, überraschend herzlich, und das ist die gute Nachricht. Egal, was wir getan haben, egal, welche Sünden wir kollektiv gegen Russland begangen haben – und wir haben viele Sünden begangen.
Das russische Volk ist... Es hat genug Herz, um zu verzeihen, was wir getan haben, und es ist bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, um voranzukommen. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir im Moment haben. Dass das russische Volk es in seinem Herzen findet, wenn dieser Krieg vorbei ist, wenn dieser Krieg endet – und wir werden nicht gewinnen, sie werden gewinnen – nicht die Art von Sieger sein, wie Amerika das ist: Ein rachsüchtiger Sieger. Wir ziehen die Menschen zur Rechenschaft.
Die Russen werden nicht so sein. Die Russen werden ein guter Nachbar sein, ein guter Bürger, ein guter Weltbürger. Und das einzig Erfreuliche an dieser ganzen Katastrophe ist, dass es einen Ausweg gibt. Es gibt Hoffnung für die Zukunft. Aber das liegt nur an der Qualität des russischen Volkes und, offen gesagt: An der Reife der russischen Regierung.
Das habe ich auf der Reise in Russland gesehen.
Danny Haiphong:
Unglaublich. Unglaublich, das zu hören.
Ich war drei Wochen lang in Europa. Ich war zufällig in Brüssel und im Land der EU, um es einmal so auszudrücken. Und es war einfach so: Man kann den Niedergang sehen. Man kann es sehr schnell an seinem Geldbeutel sehen, denn überall, wo man hinkommt – ich war auch in Deutschland – sind die Preise verrückt. Man kann sehen, wie die Infrastruktur zerbröckelt – sogar diese wunderbaren Züge, die… Wir leben in den Vereinigten Staaten, also gibt es nur sehr wenig von der Art Züge, die man in Europa sieht – aber sogar ihre Züge: Sie gehen kaputt. Sie halten an, sie werfen die Leute aus den Zügen und sagen Ihnen: "Ups, tut mir leid, Sie werden Ihren Standort nicht erreichen." Es gibt keine Arbeiter, weil sie überall einsparen.
Und ich frage mich, Scott, was denkt Russland über das, was vor sich geht? Was denken die Menschen, mit denen Sie in Russland gesprochen haben, über die Geschehnisse in den USA und in Europa? Denn es scheint, wie Sie sagten, dass Russland im Aufwind ist. Es wächst. Es wird stärker. Und auf der anderen Seite leiden genau die Länder, die NATO-Länder, die EU, die Vereinigten Staaten, die diesen Stellvertreterkrieg führen, unter ziemlich schlimmen Konsequenzen. Das ist ganz offensichtlich.
Ich meine, die Preise in Deutschland sind einfach nicht von dieser Welt. Ich war in Prag und in der Tschechischen Republik: Die Preise – damit kann man nicht leben. Ich weiß nicht, wie irgendjemand dort leben kann, angesichts der Löhne und wie die Inflation sie dezimiert hat. Und dann sieht man überall Ukraine-Flaggen, überall! Es war einfach zum Verrücktwerden: Überall, wo man hingeht: Ukraine-Flaggen. Geschäfte ändern ihre Marken und ihre Schilder, um die ukrainische Flagge anzubringen. Es war wirklich widerlich, das zu sehen.
Aber ich frage mich: "Was denken die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, über das, was in den USA und in Europa passiert?
Scott Ritter:
Nun, lassen Sie mich zunächst Folgendes sagen: Die Vereinigten Staaten haben gemeinsam mit Europa massive Sanktionen gegen Russland verhängt, und zwar mit dem Ziel, dem russischen Volk Schaden zuzufügen, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen, Menschen ihren Arbeitsplatz, ihre Existenzgrundlage zu nehmen, die russische Infrastruktur zum Einsturz zu bringen, Probleme zu verursachen. Und wenn das passiert wäre, würden sich die Amerikaner selbst bejubeln: "Oh ja, Mann, wir haben es geschafft! Ha, ha, ha, wir haben den Rubel zerstört, Baby! Wir haben Russland zu Fall gebracht! High-Five! Lasst uns ein Bier trinken! Hey, Amerika ist großartig! Wir haben den Russen Schmerzen zugefügt! Sind wir nicht gute Menschen!"
Aber nun... Die Russen haben nicht damit begonnen, Europa oder den Vereinigten Staaten Schmerz zuzufügen. Das war nie ihr Ziel. Aber wegen der Sanktionen, die wie ein Bumerang auf Europa und die Vereinigten Staaten zurückschlagen, gibt es Probleme.
Und ich sage Ihnen eines: Nicht jeder Russe... Ich meine, alle Russen sind darüber verärgert. Sie sind nicht glücklich darüber. Einige von ihnen sagen: "Nun, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, wisst ihr. Wir haben das nicht gewollt, aber ihr habt es euch selbst zuzuschreiben. Es tut uns leid. Das passiert mit euch."
Manche Russen weinen. Sie fühlen sich schlecht deswegen. Nicht... Sie fühlen sich nicht schuldig. Aber das sind Menschen, die so verdammt menschlich sind, so verdammt menschlich, dass sie emotional werden, wenn sie hören, was passiert. Es schmerzt sie. Sie haben Empathie. Sie haben Mitgefühl. Es sind einfach verdammt gute Menschen, verdammt gute Menschen! Es gibt keinen Russen, der sich darüber lustig macht, dass die Deutschen hohe Energiepreise zahlen, dass deutsche Arbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren, dass die Amerikaner bestraft werden usw. Ich habe nicht einen einzigen Russen getroffen, der gesagt hätte: "Oh ja, Baby, die Amerikaner spüren den Schmerz! Wir sind glücklich!" Nichts von alledem!
Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo in Russland Leute gibt, die einen Freudentanz aufführen, wenn sie hören, dass Amerika leidet. Und ja, seien Sie ehrlich! Ich kann es ihnen nicht verdenken. Aber jeder Russe, den ich getroffen habe – vielleicht, weil sie einen Amerikaner getroffen haben und nicht zeigen wollten, was sie wirklich empfinden.
Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie sehr offen sind. Das Einzige, was ich Ihnen über die Russen sagen kann, ist: Sie sind wie ein offenes Buch. Nun bleibt dieses Buch die längste Zeit verschlossen, weil sie etwas zurückhaltend sind und so weiter. Aber wenn sie sich hinsetzen und dich kennen lernen wollen, dann öffnet sich das Buch und sie blättern durch alle Seiten: Das ist, wer ich bin. Das ist, wer wir sind. Die Russen, mit denen ich zu tun hatte, haben sich geöffnet und das Buch aufgeschlagen.
Und die Menschen weinten über das, was hier passiert. Es tat ihnen leid. Sie waren emotional. Sie wollten nicht, dass das passiert. Sie wollen nicht, dass es passiert. Das ist einfach die gottverdammte Wahrheit. Die Russen sind nicht schadenfroh über das Leid, das verursacht wird, und einer der Gründe dafür ist, dass die Russen Leiden kennen.
Sehen Sie, in Amerika... Sie und ich wissen, dass wir Menschen haben, die leiden. Sehen Sie sich das Heer der Obdachlosen in diesem Land an. Sehen Sie sich jeden an, der von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck lebt. Ich habe versucht, den Russen das zu erklären: "Wisst Ihr, Ihr denkt, ich bin Amerikaner und bin reich, und ich kann euch ein Foto von meinem Haus zeigen, auf dem Ihr zwei Autos in der Einfahrt seht. Und Ihr denkt euch: 'Wow, Dir geht es gut.'" Und ich sage: "Wow, mir geht's nicht gut! Ich verliere alles, wenn nur zweimal der Gehaltsschecks ausfällt! Alles! Die Bank wird mir mein Haus wegnehmen. Die Bank wird mir meine Autos wegnehmen, denn ich zahle das Auto auf Raten ab. Ich bezahle das Haus so. Ich bin bis obenhin verschuldet, wie jeder Amerikaner. Und ich bin zwei ausbleibende Gehaltsschecks, manchmal auch nur einen ausbleibenden Gehaltsscheck davon entfernt, alles zu verlieren. Es ist stressig, Amerikaner zu sein. Sie wissen schon, die Krankenversicherung: Wenn man das Glück hat, einen Arbeitgeber zu haben, der sie anbietet. Das ist buchstäblich so: Die Prämien verdoppeln sich jedes Jahr, und für diese Verdoppelung bekommt man immer weniger Leistungen. Sie kürzen die Leistungen. Sie verdoppeln die Prämien. Aber stellen Sie sich jemanden vor, der sich in Obamacare eingekauft hat! Sie können sich Obamacare nicht leisten, denn Obamacare verlangt, dass Sie fünf- bis zehntausend Dollar auf der Bank haben, um im Falle eines Krankenhausaufenthalts die Zahlung leisten zu können. Andernfalls können Sie sich die Zahlung für Obamacare nicht leisten, um das Platin-Programm zu bekommen. Ich kann es mir nicht leisten. Die meisten Leute kaufen schließlich die Mindestversicherung, was bedeutet, dass sie Selbstbehalte haben, die sie sich nicht leisten können, wenn sie tatsächlich krank werden. Das ist die Realität in Amerika! Studentenschulden bis zum Gehtnichtmehr, alle Schulden bis zum Gehtnichtmehr. Und so haben die Leute den Eindruck, dass hier alles einfach ist. Es ist nicht leicht hier! Es ist hart in Amerika! Es ist schwer, ein Amerikaner zu sein, das zu erhalten, was wir haben."
Aber die Russen sind schockiert, wenn sie davon erfahren. Sie sind schockiert. Sie fragen sich: "Moment mal, was ist mit diesem ganzen Wohlstand?" Ich sagte: "Er ist künstlich. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der wir uns etwas vormachen, indem wir immer weiter kaufen. Aber wenn wir weiter kaufen, machen wir meistens auch mehr Schulden. Das setzt uns also noch mehr unter Druck. Und um uns dann besser zu fühlen, müssen wir losziehen und die nächste Xbox oder, ich glaube, man nennt es immer noch Xbox, oder eine PS5 kaufen. Ist es eine PS5? Ich weiß es nicht, weil ich das nicht brauche. Aber meine Tochter benutzt es... Man muss also mit den anderen mithalten können. Man muss sich das neue iPhone zulegen, was auch immer. Aber nochmal: Um es zu bekommen, macht man mehr Schulden, was bedeutet, dass das Problem mit dem Gehaltsscheck zu einem noch größeren Problem mit dem Gehaltsscheck wird."
Ich sage nicht, dass die Russen keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben. Die haben sie. Aber sie leben nicht in der ständigen Angst, ihr Haus zu verlieren, ihre Arbeit zu verlieren, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren, nicht mehr zur Schule gehen zu können, denn so funktioniert Russland nicht. In Russland lässt es sich ganz gut leben.
Ich werde dort nicht leben, denn ich bin Amerikaner. Ich gehöre hierher, nach Amerika. Meine Aufgabe ist es, mein Land zu reparieren. Ich liebe mein Land. Aber ich bin ehrlich genug zu sagen, dass die Lebensqualität in Russland anständig ist. Sie wird besser, und sie geht über rein konsumorientierte Dinge hinaus.
Sehen Sie, Amerikaner neigen dazu, die Lebensqualität danach zu beurteilen, was wir besitzen, was wir erworben haben. Die Russen beurteilen die Lebensqualität nach der Lebensqualität, das heißt: Kann ich mit meinen Freunden ausgehen? Kann ich in den Urlaub fahren? Kann ich einfach durch die Straßen schlendern und durch einen Park gehen, ohne Angst haben zu müssen, überfallen zu werden, in ein Museum gehen und die Geschichte genießen. Das ist Lebensqualität für die Russen. Und die meisten Amerikaner haben das nicht, weil wir lange arbeiten müssen. Wir kommen nach Hause, wir essen, wir gehen ins Bett, wir stehen auf, wir gehen wieder zurück, wir arbeiten lange. Das ist unser Leben. Die Qualität ist also das, was wir bekommen können, was wir kaufen können, basierend auf dieser Arbeit, um uns billigen Nervenkitzel oder was auch immer zu bieten. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, innezuhalten und an den Rosen zu riechen, wie es in einem alten Country- und Western-Song heißt.
Die Russen tun das. Die Russen riechen jeden Tag an den Rosen.
Info: https://seniora.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3998&urlid=4420&mailid=1897
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.


 globalbridge.ch, vom 07. September 2023 Von:
globalbridge.ch, vom 07. September 2023 Von: