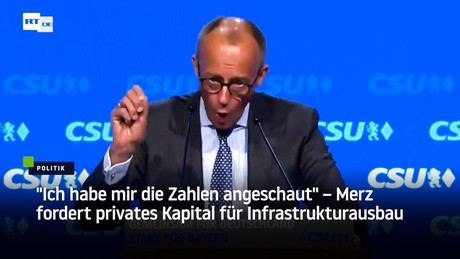Will Russland sich stark machen, um die Nato anzugreifen?
aus e-mail von Doris Pumphrey, 27. Oktober 2025, 20:06 Uhr
Berliner Zeitung 26.10,2025
26.10.2025
*Moskaus Rüstungsindustrie:
Will Russland sich stark machen, um die Nato anzugreifen?
*von Jan Opielka
Der neue Chef des Bundesnachrichtendienstes, Martin Jäger, stieg in sein
neues Amt mit einem lauten Statement ein. „Wir stehen schon heute im
Feuer“, sagte er in einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen
Kontrollgremiums des Bundestages am 13. Oktober angesichts der
vermeintlichen Bedrohung durch Russland. „Wir dürfen uns nicht
zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme
frühestens 2029.
Bislang steht, spätestens seit Juli 2024, als
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erstmals einen konkreten
Zeitrahmen nannte, das Jahr 2029 als Datum für einen möglichen oder
wahrscheinlichen russischen Angriff auf einen Nato-Staat im Raum. Für
Jägers nun vorgezogenen möglichen Angriffszeitpunkt sind die mutmaßlich
steigenden Desinformationsaktionen, Sabotageakte, Drohneneinfälle und
Spionage in EU-Staaten durch Russland ein Beleg. Diese hätten sich in
den vergangenen Monaten verschärft. Russland, so der seit September
amtierende ehemalige Botschafter Deutschlands in der Ukraine, wolle mit
diesen feindlichen Akten die Nato untergraben und die Gesellschaften
spalten. Europa solle laut Jäger nach dem Willen Moskaus von Furcht und
Handlungsstarre gelähmt und in die Selbstaufgabe getrieben werden. „Um
dieses Ziel zu erreichen, wird Russland, wenn nötig, auch eine direkte
militärische Auseinandersetzung mit der Nato nicht scheuen.“
*Angriff oder Verteidigung
*Eine direkte militärische Auseinandersetzung, und zuvor Sabotage, um
die Gesellschaften Europas zu spalten? Die jüngsten, vermeintlich
bewusst von Russland nach Polen gesteuerten Drohnen-Einflüge etwa, oder
auch die vermeintlich russischen Drohnen-Vorfälle in Dänemark oder in
München
<https://www.tagesschau.de/inland/muenchen-flughafen-drohnen-102.html> sollten
den Kreml eigentlich hinreichend lehren, dass Provokationen genau das
Gegenteil von Spaltung bewirken. Als Ergebnis der nach Polen am 10.
September eingedrungenen Drohnen beschloss die Nato etwa, ihre Präsenz
an der sogenannten Ostflanke zu verstärken, das Schlagwort dazu heißt
Eastern Sentry
<https://www.gov.pl/web/primeminister/eastern-sentry-nato-responds-to-russian-provocations-in-poland>.
Glaubt man also im Westen tatsächlich, Russland wüsste nicht längst,
dass Provokationen seinerseits zu einem größeren Schulterschluss unter
den europäischen Nato-Staaten führen, und nicht zu ihrer Desintegration
– die Abweichler in Ungarn und Slowakei hin oder her? Und glaubt man
tatsächlich, der Kreml wüsste nicht auch, dass wenn Russland tatsächlich
die baltischen Staaten oder Polen überfallen würde, Deutschland und
andere Staaten des Westens diese Länder unterstützen würden – zumindest
mit erheblichen Waffenlieferungen, und das entweder aufgrund des
Nato-Artikels 5 oder schon alleine aus nachvollziehbarer Staatsräson
heraus, um einen Puffer zwischen sich und dem Gegner zu halten?
Die Argumentationsweise von Jäger und anderen offenbart, bei nüchterner
Betrachtung, inzwischen eine Dissonanz, die nur dadurch nicht als solche
auffällt, weil sie in einer sich verselbstständigenden Blase
funktioniert, wie Raphael Schmeller nach einem Brüssel-Besuch im Juni
dieses Jahres trefflich analysierte
Das Problem an dieser Blase ist dabei zum einen, dass jeder
unaufgeklärte Vorgang zu Unfällen oder Drohnenflügen von vornherein
Russland zugeschrieben wird. Dass die Wirklichkeit nur wenige Tage
später ganz anders aussehen kann, zeigten etwa die angeblichen
russischen GPS-Störmanöver beim Flug Ursula von der Leyens nach
Bulgarien
der Gebäudeschaden der Drohneneinfälle in Polen, den Recherchen einer
polnischen Zeitung als durch eine polnische Rakete verursacht enthüllten
anders als es die Regierung in Warschau zunächst vor dem
UN-Sicherheitsrat behauptete. Durch solche Vorab-Urteile aber rückt der
zweite bedeutende Aspekt in den Vordergrund: Von einer nüchternen
politischen Analyse der Gesamtlage, von Motiven und wahrscheinlichen
Szenarien, die sich der Realität unvoreingenommen zu nähern versuchten,
ist längst nicht mehr die Rede. Denn eine solche Analyse würde
beinhalten, auch selbstkritische Aspekte zu beleuchten.
Dieser selbstkritische Blick müsste etwa ins Auge fassen, dass die
derzeitige hysterische Aufrüstungsspirale wie eine Walze über bestehende
oder dringend benötigte neue Rüstungskontrollverträge hinwegfährt. In
einer aufschlussreichen, nüchternen Analyse hat die französische
Journalistin Hélène Richard in der Zeitschrift Le monde diplomatique
unlängst auf das daraus resultierende „Sicherheitsdilemma“ aufmerksam
gemacht
<https://www.woz.ch/lmd/25-04/wie-real-ist-die-russische-bedrohung/!RNHZ4DNDFYK6>,
das Militärstrategen wohlbekannt sei. „Wenn es keine internationalen
Vereinbarungen gibt, interpretieren beide Parteien die
Verteidigungsmaßnahmen der Gegenseite als offensive Aktionen, worauf sie
ihre militärischen Kapazitäten weiter ausbauen. Dadurch wird das
Bedrohungsgefühl beim Gegner erneut verstärkt und so weiter“, so
Richard. Dieses entscheidende „Und so weiter“ sei eben vor allem deshalb
besorgniserregend, weil in Europa „kaum noch Instrumente zur
Rüstungskontrolle übrig geblieben sind“. Der Vertrag über konventionelle
Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag)
<https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_Konventionelle_Streitkr%C3%A4fte_in_Europa> aus
dem Jahr 1990 sei 2007 ausgelaufen. Das sogenannte Wiener Dokument
welches den Austausch von Informationen über Militärmanöver ab einer
bestimmten Größenordnung regele, sei nur von 1990 bis 2020 in Kraft
gewesen. Und auch der eminent wichtige Intermediate Range Nuclear Forces
Treaty (INF-Vertrag) von 1987, der die Vernichtung aller nuklearfähigen
Mittelstreckenraketen (zwischen 500 und 5500 km) vorsah
<https://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag#Diskurs_zum_Ausstieg_der_USA_aus_dem_INF-Vertrag>,
wurde 2019 von den USA unter Donald Trump aufgekündigt – begründet mit
dem Vorwurf, die Russen würden den INF unterlaufen. „Die sukzessive
Verschrottung dieser friedensbewahrenden Instrumente markiert zugleich
die Geschichte der letzten Kriege auf dem europäischen Kontinent“, so
Richard.
Nun rüsten also alle Seiten beinahe ohne Einschränkungen auf – sie
füllen das Pulverfass auf, das immer leichter entzündlich wird. Man
sollte dabei nicht vergessen: Analog zu den Nato-Vorwürfen an Russland,
es würde in EU-Staaten Provokationen durchführen, bezichtigt Russland
umgekehrt Nato-Staaten, die Ukraine bereits jetzt massiver zu
unterstützen, als zugegeben werde. Mittwoch dieser Woche etwa warf der
Chef des russischen Geheimdienstes FSB, Alexander Bortnikov,
Großbritannien vor, dass „Spezialeinheiten der British Armed Forces
(SAS) direkt an Kampfhandlungen beteiligt“ seien. Bortnikov sagte, dass
„unter der Schirmherrschaft der britischen Sonderdienste (...)
Terrorakte und Sabotageakte auf dem Territorium der Russischen
Föderation durchgeführt werden“. Konkret nannte er die ukrainische
Operation „Spiderweb“, bei der Flugplätze und strategische Bomber tief
im Inneren Russlands angegriffen wurden
<https://www.newsweek.com/putin-fsb-nato-russia-attacks-ukraine-war-uk-10887113>.
Die britische Regierung wertete solche Anschuldigungen in der
Vergangenheit als Propaganda. Bereits im Juni sagte der russische
Vize-Außenminister Alexander Grushko, die Nato wolle ihrerseits die
Region rund um das Baltische Meer in eine „Zone der Konfrontation“ und
ein „inneres Nato-Meer“ verwandeln
*Fakten oder Perspektiven
*Diese lange Einleitung sollte dazu dienen, nachzuvollziehen, unter
welchen Vorzeichen die russische Rüstungspolitik und die massive, aber
auch gezielt gesteuerte Aufrüstung ggf. zu sehen ist – die heutige und
die morgige. Denn dass Russland mit seiner exorbitant hochgefahrenen
Rüstungsproduktion weit jenseits des Ukrainekrieges plant, scheint klar
zu sein. Die Frage ist nur: Für einen Angriff? Oder für künftig bessere
Verteidigungsfähigkeiten – und künftige Exporte?
Laut einer detaillierten Analyse der finnischen Zentralbank (BOFIT)
plant der Kreml eine Steigerung von rüstungsrelevanten
Produktionszweigen – Metallprodukten, Elektronik und Computern,
Transportausrüstung – in den Jahren 2024 bis 2028 um 30 bis 50 Prozent.
Zugleich soll der Verteidigungshaushalt bis 2028 in etwa auf dem
aktuellen Niveau bei gut sieben Prozent des BIP verbleiben
was 2027 und 2028 einem Nominalwert von umgerechnet 160 Mrd. US-Dollar
entsprechen soll (2025: 143 Mrd. US-Dollar)
Auch wenn die absolute Zahl der russischen Kriegs- und Rüstungsausgaben
angesichts der entsprechenden (und geplanten) Mittel alleine der
europäischen Nato-Staaten (2025: etwa 560 Mrd. USD)
der EU keine allzu großen Ängste erzeugen sollte, so hat sich zugleich
die russische Rüstungsproduktion seit den 2008 eingeleiteten sogenannten
Serdjukow-Reformen und vor allem seit 2022 überaus schnell modernisiert.
Noch in den 2010er-Jahren etwa bezog Russland für seine Waffenproduktion
35 bis 60 Prozent an wichtigen Technologien der rechnergestützten
numerischen Steuerung (CNC) aus dem Ausland, vornehmlich aus Westeuropa,
den USA und Japan
Dies führte nach Ansicht von Experten zu einer schrittweisen
Modernisierung der russischen Rüstungsindustrie, die seit der Umstellung
im Jahr 2022 auf die Kriegswirtschaft – mit konkreten Maßnahmen, etwa
staatlichen Verfügungen an private Betriebe, erhöhter Arbeitszeit in
Rüstungsunternehmen etc. – in den Folgejahren nicht nur einen
qualitativen, sondern auch einen quantitativen Schub erfahren hat.
Allein der staatliche Rüstungskonzern Rostec hatte im Jahr 2024 einen
Umsatz von rund 39 Mrd. US-Dollar. Das Internationale Institut für
Strategische Studien (IISS) veröffentlichte im November 2024 eine
Analyse, laut der an fünf Standorten Produktionserweiterungen im Gange sind.
Auch die Zahl der bei Angriffen eingesetzten Raketen und vor allem von
Drohnen hat sich innerhalb des letzten Jahres massiv erhöht. Waren nach
Angaben des Fachportals „European Security & Defense“ im Zeitraum von
September 2022 bis 2024 insgesamt gut 11.000 Raketen und Drohnen bei
Angriffen auf die Ukraine eingesetzt worden, so wurden etwa alleine im
Mai 2025 rund 4000 Drohnen auf die Ukraine geflogen. Inzwischen
produzieren die rund 1400 russischen Unternehmen der Branche auch einst
importierte Waffen weitgehend selbst. Die iranischen Shahed-Drohnen, die
Russland inzwischen als Geran-2 in Lizenz selbst fertigt, sind dafür ein
bekanntes Beispiel. Auch die Produktion von Panzern wird hochgefahren.
Nach Informationen des Analyseprojekts Frontelligence bereitet der Kreml
dabei einen langfristigen Ausbau seiner Panzerflotte vor. Im Mittelpunkt
steht dabei eine modernisierte Version des Modells T-90 im Zentrum.
Interne Unterlagen des Herstellers Uralwagonsawod zeigen demnach, dass
Russland seine Kapazitäten bis in die 2030er-Jahre hinein stark
erweitern will
Dabei sollte es auch nicht zwingend (nur) als Schwäche der russischen
Rüstungsindustrie gewertet werden, dass der Export russischer Waffen
seit 2022 deutlich abgenommen hat. Denn der Waffen-Output wird zum einen
größtenteils von den russischen Streitkräften geordert und eingesetzt.
Zudem zeigen auch Sanktionen oder Sanktionsdrohungen ihre Wirkung auf
bisherige bzw. potenzielle Käuferstaaten – gleichwohl nicht auf alle.
Laut dem SIPRI-Forschungsinstitut gingen in dem Zeitraum 2020–2024
insgesamt 74 Prozent der russischen Waffenexporte in Staaten in Asien
und Ozeanien, zwölf Prozent in Staaten in Afrika, 7,4 Prozent nach
Europa (Armenien, Belarus und Serbien) und 6,4 Prozent in den Nahen
Osten. Zwei Drittel der russischen Waffenexporte gingen zwischen 2020
und 2024 an Indien (38 Prozent), China (17 Prozent) und Kasachstan (elf
Prozent)
<https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-03/fs_2503_at_2024_0.pdf>.
Doch dieser Ist-Zustand könnte als Folie für die Zukunft täuschen. So
geht aus einem von der ukrainischen Hackergruppe „Black Mirror“ im
September dieses Jahres veröffentlichten Bericht hervor, dass Russland
nach wie vor auf ein breites Netz von ausländischen Partnern
zurückgreifen kann. Aus den Angaben der Gruppe, die sich auf interne
Dokumente des russischen Rüstungskonzerns Rostec beziehen sollen, geht
auch hervor, dass Moskau seine Waffen in naher Zukunft verstärkt
exportieren könnte
Das betrifft etwa das Kampfflugzeug Su-35, von dem im Zeitraum 2026–2028
knapp 50 Einheiten an den Iran geliefert werden sollen. Den Dokumenten
zufolge soll auch Algerien zwölf russische Tarnkappenjäger vom Typ Su-57
sowie 14 Stück der Su-34-Jagdbomber bestellt haben. Träfen die Angaben
zu, wäre Algerien der erste ausländische Kunde für Russlands modernstes
Kampfflugzeug der fünften Generation, das laut dem deutschen Fachportal
für Militärfragen Europäische Sicherheit & Technik (ESuT) die Antwort
Moskaus auf den US-Tarnkappenbomber F-35 ist
Klar ist, dass Berichte wie diese unter dem Vorbehalt stehen, dass sie
ungeprüft sind und zugleich als Instrument der Informationspolitik bzw.
Propaganda dienen können – in diesem Fall mit dem Ziel zu zeigen, dass
Russland Verbünde mit Staaten eingeht, die ins Visier westlicher Staaten
geraten sollen. (…) Nimmt man jedoch etwa die mögliche Lieferung der
Su-Tarnkappenjets an Algerien als wahrheitsgemäß an, und berücksichtigt
zugleich, dass Russlands Streitkräfte laut ESuT nur über eine geringe
Zahl dieser Flieger verfügen, bedeutete dieser Schritt zweierlei: dass
Russland zum einen internationale Partner hat, die zugleich etwa auch
Beziehungen zur EU unterhalten (siehe Migrationsdeal EU–Algerien), zum
anderen, dass es langfristige Kooperationen eingeht, die seiner
künftigen Isolierung vorbeugen sollen.
Auch die Situation der Gesamtwirtschaft Russlands ergibt kein
einheitliches Bild. Tatsächlich wirken sich etwa die Primär- und
Sekundärsanktionen des Westens auf den Zustand der Ökonomie aus. Doch
Kernzahlen zeigen auch: Trotz immenser Kosten für die Kriegsführung ist
das Land ökonomisch, wenn nicht stabil, so doch zumindest weit von einer
massiven Krise entfernt. Das Wirtschaftswachstum in Russland wird im
laufenden Jahr – so die Prognosen internationaler Analysten, aber
inzwischen auch der russischen Regierung – bei rund einem Prozent
liegen. Eine deutliche Abschwächung gegenüber dem Vorjahr, als es noch
ein Wachstum von mehr als vier Prozent gab
Zwar sagt etwa der Erste Vizepremier Alexander Nowak, dass im kommenden
Jahr die Wirtschaft wieder kräftig um etwa vier Prozent wachsen solle
Doch dies könnte sich als Trugschluss erweisen. Die Weltbank etwa geht
bei ihren Prognosen davon aus, dass die straffe Geldpolitik, die die
relativ hohe Inflationsrate (2025: 7,5 Prozent) auf vier Prozent drücken
soll, auch ökonomische Impulse abwürge, sodass die russische Wirtschaft
auch in den Jahren 2026 und 2027 um je nur knapp ein Prozent wachsen
werde
Zwar sind durch den Krieg und die Unvorhersehbarkeit seiner weiteren
Entwicklung solche Prognosen mehr denn je mit Vorsicht zu genießen.
Gleichwohl: Trotz des sinkenden Außenhandelsüberschusses etwa wegen
geringerer Erlöse aus Erdgas- und Erdölexporten und wachsender Importe
liegt die Staatsverschuldung Russlands bei vergleichsweise geringen 14
Prozent des BIP (USA im Jahr 2024: 120,8 Prozent; Deutschland 2025: 62,7
Prozent). Und auch das von der Weltbank für die kommenden zwei Jahre
prognostizierte Haushaltsdefizit Moskaus liegt bei unter drei Prozent,
der (einst) streng geltenden EU-Vorgabe für ihre Mitgliedsstaaten.
Russland scheint also für die Fortführung des Krieges gerüstet. Wohl
auch daher ist die Ukraine dazu übergegangen, Ziele in Russland selbst
anzugreifen, um entweder die militärischen Produktions- und
Transportkapazitäten oder aber die Energieproduktion zu schwächen – oder
beides. Unterstützt wird sie dabei von seinen Verbündeten. Wenige Wochen
vor der jüngsten Drohung von US-Präsident Donald Trump, die USA könnten
der Ukraine Tomahawk-Raketen liefern, die Reichweiten von bis zu 2500
Kilometern haben
hat der einflussreiche US-Thinktank Hudson-Institute in einer Analyse
„acht hochwertige und militärisch plausible Ziele“ identifiziert, „die
die Ukraine verfolgen sollte, um die Kriegsführungsfähigkeit Russlands
zu schwächen und die politischen Kosten für die Invasion und Besetzung
ukrainischen Territoriums zu erhöhen
Zu den Zielen gehören demnach der Wolga-Don-Kanal als Verbindungsstück
zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer, der etwa auch
Waffenlieferungen aus dem Iran unterbinden würde; die Energieversorgung
der russisch-iranischen Drohnen-Produktionsstätte in der russischen
Republik Tatarstan; die russisch-chinesische Bahnverbindungsstrecke
Zabaikalsk–Manzhouli; der russische Flottenstützpunkt Ochamchire am
Schwarzen Meer in Abchasien; sowie vier Brücken, die Russland mit der
Krim verbinden – darunter die Kerch-Brücke. Für die letztere, so die
Autoren des Hudson-Institute-Reports, sei der Einsatz der deutschen
Taurus-Raketen optimal. Die Ukraine könnte aber auch ein Gebiet in
Transnistrien angreifen, das derzeit von rund 1500 russischen Soldaten
kontrolliert werde. „Die Ukraine würde durch die Eroberung der von
Russland gehaltenen Gebiete in Transnistrien an Einfluss in der
Eskalation-Dominanz gegenüber dem Kreml gewinnen“, heißt es dazu in dem
Bericht
Nicht nur diese militärisch-strategischen Überlegungen zeigen, ähnlich
wie die vagen Szenarien westlicher Politiker und ihrer Geheimdienste: Es
geht nur noch um militärisch-technologische Fragen und faktisch um ein
Spiel mit der Eskalation. Politische Maßnahmen, die die Realitäten des
Kräfteverhältnisses zwischen Russland und der Ukraine berücksichtigen
würden und die täglichen Todesopfer zur Kenntnis nähmen, spielen keine
ernsthafte Rolle. Dazu gehörte die wichtigste Frage: Warum sollte
Russland, nach dem Krieg in der Ukraine, die Nato angreifen wollen – vor
dem Hintergrund, dass es trotz massiver Aufrüstung militärisch schwächer
ist und sein wird als die Nato? Könnte Russland durch eine „hortende“
Aufrüstung – erhebliche Teile der modernsten Waffen werden nicht in der
Ukraine eingesetzt – nicht vielmehr einen Schutzwall gegenüber einer von
Moskau befürchteten, stärkeren Nato-Beteiligung am Ukrainekrieg und
allem, was ihm folgen könnte, aufbauen? Denn analog zu den in westlichen
Staaten verbreiteten Ängsten, Moskau könnte in den kommenden Jahren
angreifen, ist in Russland die Überzeugung verbreitet, der Westen wolle
Russland zerstören und die riesige Föderation zum Zerfallen bringen.
Die Weigerung, die Perspektive der anderen Seite ernst zu nehmen, kostet
jeden Tag neue Menschenopfer – und bringt horrende Gewinne für die
Waffenhersteller, die nichts weniger fürchten als den „Ausbruch des
Friedens“. Für sie ist die Ukraine längst zum „Silicon Valley der
Verteidigungsindustrie“ geworden, sagt Franziska Cusumano, Chefin der
Sparte Mercedes-Benz Special Trucks (MBS), die bei Daimler Trucks die
Militärfahrzeuge herstellt. „Wir haben uns als großes Ziel gesetzt, die
Nato-Staaten bei der Bewältigung aller neuen Anforderungen zu
unterstützen.
Das ist der inzwischen etablierte Neusprech – Waffengeschäfte sind
„Unterstützung“, und ein „Papiertiger“, dessen U-Boot
Nato-Generalsekretär Mark Rutte jüngst als „einsam, kaputt und humpelnd“
verspottete,
plant einen Angriff auf die Nato. Realitäten, Provokationen, Narrative
und Fiktionen vermengen sich zu einem gefährlichen Gebräu.
unser Kommentar: Als Information zur Kenntnisnahme, wobei für uns das kriegerische Geschehen, wie z. B. in der Ukraine sowie in Israel, Palästina und sonstwo, keinerlei Zustimmung bzw. Rechtfertigung erhält.







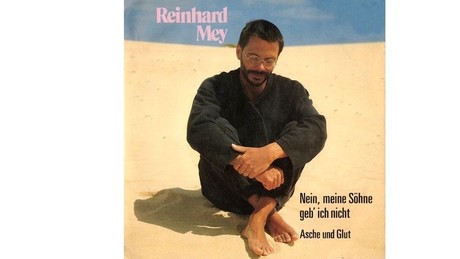 © Screenshot: Webseite Discogs
© Screenshot: Webseite Discogs






 Kai Ehlers (li.) 2006 in der Mongolei. (Bild von Bernd vdB – Eigenes Werk via wikimedia commons | CC BY 3.0)
Kai Ehlers (li.) 2006 in der Mongolei. (Bild von Bernd vdB – Eigenes Werk via wikimedia commons | CC BY 3.0)